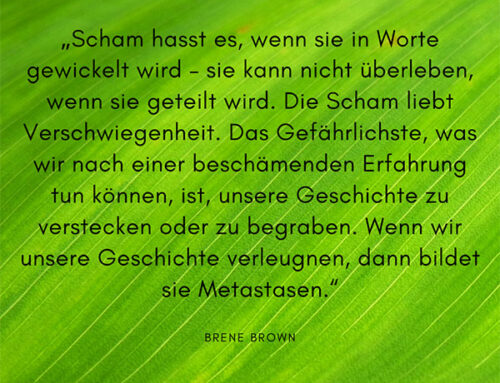Heute vor 9 Jahren wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. M. und ich fuhren zusammen in die Psychiatrie – er blieb dort.
Ich komme aus einer bis fast zur Langweiligkeit psychisch stabilen Familie – psychische Erkrankungen – das gab es einfach nicht. „Soll sich mal bissle zusammenreißen, dem geht’s viel zu gut“. Mit dieser Überzeugung war ich aufgewachsen. Und viel schlimmer noch: „Da stimmt doch was in der Familie nicht, bei der Frau würde ich auch wahnsinnig werden“…. Und plötzlich war ich selbst „diese Frau“.
Psychiatrie: Das war für mich „Einer flog übers Kuckucksnest“, über endlose Gänge schlurfende Menschen mit zerzausten Haaren, Zwangsjacken und Betonspritzen – kurz, ein absolutes Horrorszenario – und da hatte ich meinen geliebten M. zurückgelassen. Diesen hochsensiblen, empathischen, liebenswerten, witzigen und verletzlichen Menschen. Nur, weil ich nicht mehr mit der Situation zurechtkam. Was für ein Armutszeugnis!
Scham, Schuld, Versagen, Angst – um M., um mich, um unsere Familie… Ich war überzeugt, ich kann nie wieder unbeschwert und glücklich werden.
„Somebody that I used to know” – dieses Lied wurde zum Soundtrack meiner Besuche in der Psychiatrie. “Jemand, den ich früher mal kannte“. Meine anfängliche Erleichterung, als nach einigen Wochen die Diagnose und damit die Therapie feststand wich sehr schnell der Ernüchterung. Die Medikamente bewirkten eben kein sofortiges Wunder – der M., den ich früher mal kannte, war immer noch wie hinter einer dichten Nebelwand. Der Mensch, den ich so sehr liebte und den ich mir so sehr zurückwünschte, er war einfach nicht mehr da. Ich glaube, M. ging es mit mir ähnlich. Ich habe viel geweint auf meinen täglichen Fahrten zwischen dem Murgtal und Baden-Baden.
Tröstlich war zumindest für mich, festzustellen, dass die Klischees, die ich über Psychiatrien im Kopf hatte, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatten. Im Gegenteil, Ärzte und Pfleger waren zugewandt, nahmen Anteil, kümmerten sich gut um M. Er war in einer sicheren Umgebung, fühlte sich weniger gequält und kam zur Ruhe.
Aber… würde irgendwann wieder alles so sein, wie es einmal war? Wie sollte es weitergehen nach der Psychiatrie – beruflich, finanziell, familiär? Die wenigen Informationen, die ich mir mühsam aus dem Internet und verschiedenen Publikationen zusammenklaubte, gaben keinen großen Anlass zur Hoffnung.
Noch viel weniger Informationen und Rat gab es für mich, die mitbetroffene Angehörige – waren wir wirklich die Einzigen weit und breit mit diesem Schicksal? Es war eine sehr einsame Zeit, die in mir aufgestauten Gefühle und Ängste, über die ich mit niemandem sprechen konnte – durfte – raubten mir oft fast den Atem. Gleichzeitig musste ich stark sein für M. – einer musste ja die Hoffnung hochhalten.
Die folgenden Jahre waren wie eine wilde Fahrt. Momente der Hoffnung und großen Freude wechselten sich ab mit herben Rückschlägen. M. und ich rangen – jeder für sich – darum, wieder unseren Platz zu finden in diesem völlig neuen Leben mit einer chronischen Erkrankung. Nicht immer gelang uns das gut, viele Wunden haben wir uns gegenseitig zugefügt. Ich wollte mit aller Verbissenheit, dass M. wieder so ist, wie er einmal war – „normal“ eben. Ich konnte und wollte nicht verstehen, dass M. sich nicht mehr anstrengte, um wieder „normal“ zu sein.
Nach einer besonders heftigen Krise fand ich eher zufällig die Website einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen. Obwohl mich die Vorstellung von Stuhlkreisen wirklich abschreckte, entschloss ich mich doch, mir so eine Selbsthilfegruppe mal anzuschauen. Gott sei Dank! Zum ersten Mal seit Jahren traf ich Menschen, die mich wirklich verstanden, die genau wussten, wie es mir ging. Ich musste mich nicht schämen, ich musste keine Maske aufsetzen, ich musste niemanden „schonen“ – wir saßen alle im selben Boot.
Ich habe so viel gelernt im Austausch mit anderen Angehörigen. Vieles, was ich lernen musste, war sehr schmerzhaft, z.B., dass M. eben vielleicht nicht mehr der Mensch wird, „den ich früher mal gekannt habe“ – dass es eben nach einer solchen Lebenskrise u.U. keinen Weg zurück zum Früher gibt, dass das Leben danach nun einmal anders sein wird. Aber ich habe auch gelernt, dass „anders“ nicht zwangsläufig schlechter sein muss. „Sie können Ihren erkrankten Angehörigen nicht verändern, Sie können sich nur selbst verändern“. Hört sich eigentlich simpel an und ist doch die größte und schwierigste Aufgabe, der ich mich bislang in meinem Leben stellen musste.
Eine schwierige Gratwanderung nach wie vor – auf mich selbst zu achten, mir zu erlauben unbeschwert und lebensfroh zu sein und gleichzeitig M. gerecht zu werden – ohne mich dabei selbst zu verlieren. Uns und unsere Beziehung nicht immer unter dem Damoklesschwert der psychischen Erkrankung zu sehen, sondern zuallererst als Rachel und M.
- und ich sind durch die Hölle gereist und haben einige Verbrennungen und Abschürfungen davongetragen. Jetzt lernen wir uns neu kennen, suchen nicht mehr verbissen den Menschen „that I used to know“ (den ich mal kannte), sondern den Menschen „that I would like to get to know“ (den ich gerne besser kennenlernen möchte“. Und diesen Menschen M. mag ich echt gerne!